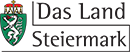Experten: "In diese Krise wurde die EU getrieben"
Strategien zur Bewältigung der Folgen bis zum Jahr 2020


Wien/Graz. (23.03.2010) - Zur Diskussion über "Europa 2020 - Eckpunkte einer neuen Reformagenda" luden die Sozialpartner Österreichs für Montag, 22. März, nach Wien. In der hochkarätig besetzten Veranstaltung wurde in aller Offenheit sowohl die Ursache der Krise angesprochen als auch die nunmehr vorliegende Strategie zu deren Bewältigung einer kritischen Analyse unterzogen. Einigkeit herrschte darüber, dass die Europäische Union nicht Verursacher sei: "In diese Krise wurde die EU getrieben", hieß es einhellig.
Regional-Kommissar Johannes Hahn stellte eingangs klar, dass Europa kein einfacher Weg bevorstehe und verwies auf die geschrumpfte europäische Wirtschaftsleistung, den Rückgang der Industrieproduktion und die um unfassbare sieben Millionen Personen gestiegene Arbeitslosigkeit.
"Die Europäische Union hat sich mit der Strategie Europa 2020 neue ambitionierte Ziele gesetzt. Es ist absolut notwendig, dass alle 27 Mitgliedstaaten an einem gemeinsamen Strang ziehen", so Hahn, der das Engagement der Sozialpartner im Bildungsbereich hervorstrich: "Bildung ist der Schlüssel, damit der Wirtschaftsstandort Österreich international reüssieren kann". Hahn legte ein Bekenntnis zu einer europäischen Wirtschaftsordnung mit sozialer Prägung ab und forderte die verstärkte Schaffung von "Green-Jobs" als einen möglichen Ausweg aus der Krise.
Fünf messbare "Kernziele" für Europa 2020
Die wichtigsten Ziele, die in dieser Woche am 25. und 26. März in Brüssel diskutiert und aller Voraussicht nach beschlossen werden:
- 75% der 20-bis 64jährigen sollen in Beschäftigung stehen (heute sind es 69%)
- 3% des BIP soll für Forschung und Entwicklung investiert werden (heute 1,8%)
- Klima- und Energieziele - Formel 20/20/20, bezw. eine Energiereduktion um 30%
- Die Zahl der SchulabbrecherInnen müsse gesenkt werden auf 10% (heute 15%) und die Zahl der Hochschulabsolventen müsse von heute 31 auf 40 Prozent im Jahr 2020 gesteigert werden
- Die Zahl der Armutsgefährdeten müsse um ein Fünftel (von derzeit 80 auf dann 60 Mio) reduziert werden
Entsprechend dieser Ziele sollen in jedem Mitgliedstaat nationale Ziele und Verlaufspläne definiert werden.
Sozialminister Rudolf Hundstorfer formulierte seine Kernforderung: "Die Schaffung einer Architektur der Finanzmärkte mit einer europäischen Finanztransaktionssteuer". Im Mittelpunkt der europäischen Anstrengungen dürfe nicht, so Hundstorfer, die rasche Gewinnmaximierung stehen, sondern es gehe um ein reales und nachhaltiges Wirtschaftswachstum.
Als europäisches Vorbild hob der Sozialminister das österreichische Kurzarbeitszeitmodell hervor. So habe Spanien dieses Prinzip übernommen. "Europa ist als Friedensprojekt gegründet worden, das heute im Besonderen gefordert ist, auch auf den sozialen Frieden zu achten. Und das sei weitaus mehr als die 'Abwesenheit von Krieg': Armut und Arbeitslosigkeit müssen gesenkt und bekämpft werden, die Bildungschancen verbessert und vermehrt werden", so Hundstorfer, der verbindliche Beschäftigungsziele einforderte. Sorgen bereite ihn der deutlicher werdende Trend des Fehlens junger und bestens ausgebildeter Arbeitskräfte. Es müsse außerdem alles unternommen werden, um die Menschen länger im Erwerbsleben zu halten.
Karl Aiginger, Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes (WIFO) las den Wirtschaftskapitänen und den EU-Granden einerseits die Leviten ("Europa hat sich vor, in und nach der Krise schlechter entwickelt
als die USA"), nahm aber die Europäische Union auf der anderen Seite in Schutz: "Die EU nimmt drei
große Rucksäcke aus der - nicht auf diesem Kontinent verschuldeten - Krise mit: die hohe Arbeitslosigkeit, das hohe Budgetdefizit, die Schulden und - besonders schwerwiegend - enorme Rückstände bei Forschung & Entwicklung sowie im Bildungsbereich".
Aiginger weiter: "Es ist eine schwierige Aufgabe für die österreichische Regierung, die Ziele von Europa 2020 mit einer Budgetkonsolidierung in Einklang zu bringen." Aus WIFO-Sicht sei eine Dreifach-Strategie notwendig:
- Beschäftigung schaffen,
- Budget konsolidieren und
- in die Zukunft investieren.
Aiginger forderte bereits für 2010 ein "Impulspaket" ein, um das Wachstum zu forcieren: "Jeder Prozentpunkt BIP-Wachstum senkt das Budgetdefizit und die Arbeitslosigkeit". Dieses Impulspaket beinhalte unter anderem ein höheres Arbeitslosengeld für jene Arbeitnehmer, die sich "radikal umschulen lassen" und einen neuen Job ergreifen sowie die probeweise Umsetzung des Handwerkerbonus für zumindest zwölf Monate und eine Forschungsprämie.
Sozialpartner ziehen an einem Strang
In der Podiumsdiskussion zeichneten die Sozialpartner durchaus unterschiedliche Bilder ihres Europa im Jahr 2020. AK-Präsident Herbert Tumpel mißfiel vor allem das Faktum, dass es sich bei dieser Strategie um einen 10-Jahresplan a lá Sowjetunion handle, betonte aber, dass er keineswegs "pessimistisch in Bezug auf EU und Österreich" sei. Aus seiner Sicht müsse alles getan werden, um die Effizienz der Apparate zu steigern. Aus Sicht der Arbeiterkammer sei es von größter Bedeutung, gegen jedes Sozial- und Lohndumping aufzutreten.
Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl fand das in der Strategie formulierte Ziel der 40%-Akademikerquote als eindeutig zu hoch gegriffen: "Was wir wirklich brauchen, sind Facharbeiter", mahnte er und schlug vor, dieses Ziel jedenfalls so zu interpretieren, dass es um die Verbesserung der Möglichkeiten zur akademischen und zur beruflichen Weiterbildung gehen müsse. Sonst zeigte er sich nicht gerade EU-phorisch, die Strategie sei eine Ansammlung von Plattitüden, es fehle die klare von Optimismus geprägte Vision. Aus seiner Sicht sei das Papier nicht unbedingt von Leuten formuliert worden, die wissen, wie man Ziele formulieren müsse, zeigte sich Leitl enttäuscht.
Für den ÖGB stellte Erich Foglar klar, dass die Strategie "Europa 2020" im großen und ganzen in die richtige Richtung weise. Was ihm fehle? Dass der Systemfehler, der zur Krise geführt habe, nicht angesprochen wird und dass man in dem EU-Papier keine definierten Meilensteine auf dem Weg ins Jahr 2020 finde. 2020 sei zu weit weg, es müssten auch die mittelfristigen Strategien und deren Zielsetzungen für 2015 dargestellt werden.
Für die österreichische Bauernschaft rundete Landwirtschaftskammerpräsident Gerhard Wlodkowski das Quartett der Sozialpartner ab: Er habe kein wirklich schlechtes Gefühl, wenn er auf die Weiterentwicklung des Agrarsektors schaue. Es gelte, gegen die Krise rasch vorzugehen und im Kampf um die Arbeitsplätze die Rolle der Landwirtschaft nicht weiter zu unterschätzen. Immerhin seien in der Lebensmittelproduktion Millionen von Menschen in Beschäftigung. Das spiegle sich bei der Aufteilung der Fördermittel nicht unbedingt wieder. 1995 war noch 60 Prozent des EU-Budgets für die Bauern vorbehalten, im Jahr 2013 würden es nur noch knapp 33 Prozent sein.