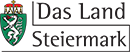Südosteuropa-Akademie: Gemeinsame "Europaplattform" für alle Studien ?


Vom Kindergarten als Bildungseinrichtung bis zum standardisierten europaweit gültigen Hochschuldiplom spannte sich der Bogen der Themen bei der letzten Diskussionsveranstaltung des Winter-Semesters im Rahmen der Südosteuropa Akademie Graz im Hotel Wiesler. Die Veranstaltungsreihe, die das Land Steiermark im Rahmen des "EuropeDirect-Informationsnetzwerkes Steiermark" als Partner der Karl Franzens Universität Graz unterstützt, wird im Sommersemester zu Wirtschafts-Themen fortgesetzt.
Als Moderator zitierte Universitätsprofessor Wolfgang Benedek eingangs einen Bericht der Balkankommission, wonach 74 Prozent der Bosnier die Bildungsperspektiven in ihrem Land für wenig Erfolg versprechend sehen.
Heute gehe es daher darum, Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu verbessern um die jungen Menschen in ihren Ländern zu halten; dass gute Bildungsmöglichkeiten dafür eine der ganz grundlegenden Voraussetzungen sei, war unbestritten.
Die angekündigte Hochschullehrerin aus Sarajevo, Lamija Tanović, konnte persönlich nicht anwesend sein. Ihrem Referat waren Daten zu entnehmen, die die Dramatik in vielen südosteuropäischen Staaten verdeutlichen: So haben 40 Prozent der Forscherinnen und Forscher Albanien den Rücken gekehrt. 62 Prozent der Studenten in Bosnien-Herzegowina möchten nach dem Studium ins Ausland. Eine der Ursachen ortet Tanović darin, dass der Wiederaufbau der Bildungseinrichtungen nach den Kriegswirren keine Priorität hatte und dass daher noch vieles im Argen liege.
Grazer Bildungskooperationen stehen auf drei Säulen
Die Grazer Amerikanistin Roberta Maierhofer, die als Vizerektorin für internationale Beziehungen die Veranstaltung eröffnet hatte, zeigte anhand der zahlreichen Kooperationen die Möglichkeiten effektiver Hilfestellung auf. Die Karl Franzens-Universität habe ihre Kooperationen auf drei Säulen gestellt. Es gebe Projekte mit Bildungs- und Wirtschaftskooperationen in den Regionen, zum zweiten Forschungsprojekte über die Regionen und weiters solche, die als Unterstützung oder Hilfestellung zu verstehen seien.
Alle drei Säulen seien mit dem Bolognaprozess verbunden und damit dem Ziel zugeordnet, „eine gemeinsame Europaplattform für alle Studien“ zu installieren. Vorbildfunktion für andere Bereiche haben die Hochschulen insoferne, als dass sie die Brückenfunktion zwischen EU und Nicht-EU-Ländern wahrzunehmen: Allein Graz hat rund 500 Kooperationen, von denen knapp die Hälfte mit Ländern außerhalb der Europäischen Union funktionierten, erklärte Maierhofer.
Sie forderte eine höhere Bereitschaft der EU ein, Bildungsprojekte zu fördern. So sei es etwa schwer gewesen, „EU-Gelder für ein Projekt in Split zu bekommen!“
Anton Dobart vom Bildungsministerium in Wien konnte in diesem Zusammenhang nur auf die Budgetvorschau 2007 bis 2013 verweisen – budgetär seien somit die Weichen gestellt. Er lobte die Rolle der Stadt Graz, deren früherer Bürgermeister Alfred Stingl es verstanden habe, die geopolitische Lage der Stadt und die der ersten Ratspräsidentschaft zu nutzen: Der 1998 gestartete „Graz-Prozess“ habe zu einem die Grenzen, Institutionen, Kulturen und Nationalitäten überschreitenden Netzwerk mit dem Ziel einer Bildungsreform geführt.
Auch wenn es verpönt sei von Investitionen in "human capital" zu sprechen – dies sei eine der wesentlichen Aufgaben, zu denen sich die Bildungsminister bekennen und „das muss – immer unter dem Aspekt der Effizienz – auch finanzielle Konsequenzen haben!“
Der Grazer Zeitgeschichtler Helmut Konrad verwies darauf, dass derzeit ein europäischer Bildungsraum im Entstehen sei. Eines der wichtigsten Ziele sei hier die gesamteuropäische Qualitätssicherung: Es sei wichtig zu erkennen, dass ein einheitliches Niveau von größtem Vorteil sei.
In der Diskussion forderte der frühere Bürgermeister der „geteilten Grenzstadt“ Bad Radkersburg, dass Bildungspolitik bereits im Kindesalter wirksam werden müsse – Verständnis für internationale Kooperationen erst ab der Hochschule einzufordern sei zu spät. Man müsse ernsthaft im Kindergarten beginnen.
Josef M. Bauer