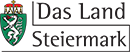"Made in Europe" als Antwort auf die Globalisierung
Großer Andrang bei Diskussion mit EU-Kommissionsvizepräsident Günter Verheugen in Graz
„Welche Qualifikationen müssen Studierende heute mitbringen, um in der Berufswelt bestehen zu können“, fragte ein Student. Ein anderer Zuhörer wollte wissen, inwiefern europäische Unternehmen denn überhaupt konkurrenzfähig sein könnten, wenn Wirtschaftsmächte wie die USA und China ökologische bzw. soziale Vorgaben weitestgehend ignorieren würden. „Unternehmen oder Unterlassen? Chancen im europäischen Unternehmenswettbewerb“ lautete der Titel der Diskussionsveranstaltung am 20. April in der TU Graz. Günter Verheugen, Vizepräsident der Europäischen Kommission, stellte sich dabei den durchaus auch kritischen Fragen des (nicht nur) jungen Publikums.

In einer mehr als eineinhalbstündigen, spannenden Diskussion in dem vom Grazer Stararchitekten Gunter Domenig gestalteten Hörsaal neben dem Betonbau-Institut machte der Kommissar deutlich, dass Globalisierung kein Ungetüm sei, vor dem sich die heimischen Unternehmen verstecken müssten; es gelte viel mehr, etwas zu „unternehmen“, um auch bei schwierigen Bedingungen erfolgreich zu bleiben. „Es muss jemand dem Herrn Landeshauptmann ausrichten, dass ich ein paar Minuten später komme“, sagte er dann nach einem Blick auf die Uhr und ging geduldig auf die letzte Fragerunde ein.
Günter Verheugen war der Einladung der TU, dem Land Steiermark mit dem Informationsnetzwerk EuropeDirect, der Vertretung der EU-Kommission in Österreich sowie der Kleinen Zeitung zu einer Diskussionsrunde mit dem Titel „Unternehmen oder Unterlassen? Chancen im europäischen Unternehmenswettbewerb“ gefolgt. Sowohl die Person Verheugens als auch das interessante Thema wirkten als „Publikumsmagneten“, sodass sich gut 150 Interessierte im Hörsaal L einfanden und diesen beinahe aus allen Nähten platzen ließen.
In seinem Einleitungsreferat schilderte Verheugen ganz persönlich: Als im Jahr 1944 Geborener hätte er nicht nur die Schrecken des Weltkrieges miterlebt, sondern sei auch Zeuge des Berliner Mauerbaus und der Kuba-Krise geworden. Das Projekt Europa hätte den entscheidenden Beitrag geleistet, dass wir heute in Sicherheit und Frieden leben können. Freilich sei ihm bewusst, dass diese Errungenschaft für die jungen Generationen heute zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist – aus welchem Grund also sollten sie überzeugte Europäer sein?
Als einer der wesentlichsten nannte er die Globalisierung. Für viele im Saal mutete dieses Statement zunächst paradox an. Gleich darauf kam aber bereits „Licht ins Dunkel“: Im Zusammenhang mit der Globalisierung sei es nicht relevant, die Frage zu stellen, ob diese „gut“ oder „schlecht“ sei. Es ginge viel eher darum, auf dieses Phänomen so zu reagieren, dass möglichst alle Menschen davon profitieren können.
Die Globalisierung, die in allen Lebensbereichen, egal ob in sozialer, politischer, ökonomischer oder ökologischer Hinsicht zu rasanten Veränderungen führt, fände nämlich auch ohne unser Zutun statt. Im Hinblick auf die Verschärfung des globalen Wettbewerbes sei es zentral, rechtzeitig zu reagieren. Europa müsse die Herausforderung der Globalisierung annehmen und sich zum Ziel setzen, zur konkurrenzfähigsten Wirtschaftsregion bei gleichzeitiger Beibehaltung der hohen Standards zu werden. Entscheidend sei hier allen voran, dass sich europäische Unternehmen darauf konzentrieren, in jenen Bereichen in den Wettbewerb zu treten, in denen sie realistischerweise auch als Gewinner hervorgehen können.
Dass dies nicht im Lohnsektor möglich sei, ist offensichtlich. Unternehmen und Produkte „Made in Europa“ müssten sich daher durch die beste Qualität, Innovation und Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen auszeichnen sowie dadurch, dass unter Rahmenbedingungen produziert wird, die hohen ökologischen und sozialen Ansprüchen gerecht würden.
Nach dieser Einführung startete unter Moderator Hubert Patterer, Chefredakteur der „Kleinen Zeitung“, die Diskussion mit dem Publikum.
Mit der Frage nach notwendigen Qualifikationen von Jungakademikern ging es gleich ins Eingemachte: „Neben dem Basiswissen, das auf der Universität vermittelt wird, sind geistige Flexibilität, Mobilität, die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen sowie vor allem Bereitschaft zur Selbständigkeit entscheidend“, so Verheugen. Gerade in der Mobilität gebe es allerdings erhebliche Probleme. Die meisten Menschen wüssten zwar, dass diese gefordert ist, seien aber heute großteils noch nicht gewillt, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen, stellte der EU-Politiker klar.
Mut zum eigenen Unternehmen
Auch der Bereich „Eigeninitiative“, also die Bereitschaft, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen, sei in Europa noch zum großen Teil unterentwickelt. Gerade hierbei sei die Politik gefordert: Unternehmensgründungen müssten flächendeckend weitaus unbürokratischer und schneller möglich werden, als dies gegenwärtig der Fall ist. In einigen Ländern sei hier allerdings bereits vieles geschehen, das in die richtige Richtung weise. Zentral sei aber auch, dass bereits in den Schulen und Universitäten das nötige unternehmerische Basiswissen vermittelt würde. Parallel dazu müsse der Gedanke, Unternehmer zu werden, aber auch insofern attraktiver werden, als dieses Berufsfeld ein positiveres Image erhalten müsse. Schließlich seien zwar bei weitem nicht alle Unternehmer Zigarren rauchende Ausbeuter im Nadelstreif, in der Öffentlichkeit sei dieses negative Bild aber leider vorherrschend.
Später ging es dann zur Konkurrenzfähigkeit Europas, zumal Wirtschaftsmächte wie die USA und China ökologische bzw. soziale EU-Vorgaben weitestgehend ignorieren würden. Verheugen sieht die Chancen unserer Wirtschaft darin, frühzeitig auf sich abzeichnende strukturelle Veränderungen zu reagieren und zu agieren. Hierbei seien einerseits die Unternehmen gefordert, die rechtzeitig in Produktinnovationen investieren müssten, andererseits aber auch die Politik. Diese müsse laufend infrastrukturelle, bildungspolitische und innovationsfördernde Maßnahmen setzen, um negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. Aber auch die Konsumenten spielen eine Rolle: sie allein seien wirklich in der Lage, Druck auszuüben indem sie der Qualität „Made in Europe“ den Vorrang einräumen.
Nach eineinhalb Stunden und nach wie vor ungebrochenem Interesse im Publikum mahnte der dichte Terminkalender, der für den Kommissar bei seinem Steiermark-Besuch so dicht wie möglich gestaltet worden war. "Ich würde gerne noch bei Ihnen bleiben", entschuldigte er sich, um in die Burg zu Landeshauptmann Voves aufzubrechen, mit dem er über die Steiermark als mögliche  "EU-Musterregion für Klein- und Mittelbetriebe" konferierte.
"EU-Musterregion für Klein- und Mittelbetriebe" konferierte.
Daniela Fruhmann - 20.4.2006