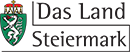Südosteuropa-Akademie: Organisierte Kriminalität - ist der Kampf schon verloren?

Es sind nicht mehr ein "Pate", der eine streng hierarchische Organisation dirigiert - es sind vielmehr Netzwerke von vielen kleinen Gruppen, die je nach Bedarf zusammen arbeiten - im Drogen- und Zigarettenschmuggel genauso wie im Menschenhandel, wo durchwegs Milliardenumsätze und -Gewinne erzielt werden; und auch im Terrorismus. Statt "tote Briefkästen zu bestücken" werden E-Mails und SMS versandt. Und Angehöriger verfeindeter Völker - wie etwa Serben und Kosovaren - arbeiten friedlich zusammen, wenn etwa junge Frauen als Nachschub herangeschafft und zur Prostituion gezwungen werden sollen. Diese Aspekte beleuchtete am 14. Juni 2007 die letzte Veranstaltung der Südosteuropa-Akademie Graz, die Zusammenarbeit der Universität Graz, der Stadt Graz, dem Internationalisierungscenter Steiermark und dem Land Steiermark stattfand. Als Praktiker am Podium: Der langjährige Polizei-Jurist Honorarkonsul Jörg Hofreiter, die früheren Frauenministerin Helga Konrad, die nun als Konsulentin im internationalen Kampf gegen Menschenhandel tätig ist, und der deutsche Europol-Experte Uwe Kranz, der für den Europarat die OK-Berichte Südosteuropa erstellt - wie man die "Organisierte Kriminalität" im Polizeijargon nennt.
Gleich vorweg: Die hochrangigen Experten betrachten den Kampf gegen organisierte Kriminalität nicht als "verloren". Erschwert werde die Bekämpfung der organisierten Kriminalität vor allem durch die hohe Internationalität und Flexibilität der Gruppen. Die organisierte Kriminalität kennt keine Grenzen und nutzt die modernen Kommunikationsmittel zu einer engen Vernetzung. Als Antwort auf diese Entwicklung werden grenzüberschreitende, präventive und komplexe Strategien gesucht. Ein großes Manko bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität besteht vor allem in der fehlenden Kooperation und dem fehlenden Datenaustausch zwischen den Staaten.
Auch die unterstützenden Staaten und Organisationen (UNO, EU etc) kollaborieren zu wenig. Vorhanden Strukturen werden nicht genug genutzt. Die Experten sehen vor allem die Korruption, die bis in hohe Funktionsklassen reichen kann, als ein großes Hindernis bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. "Die Opfer von Menschenhändlern trauen sich nicht zur Polizei zu gehen", unterstreicht Helga Konrad. Nicht nur, weil sie durch Schläge und Brandverletzungen gefügig gemacht worden sind, sondern auch, weil sie davon ausgehen, dass die Beamten bestochen seien und mit den Kriminellen unter einer Decke stecken, schildert sie aus der Praxis. Was aber, wenn ein Fall doch den Behörden bekannt wird? Die Opfer werden abgeschoben, die Hintermänner besorgen neues Menschen-Material, das von "Aufreissern" - oft vertrauensvoll erscheinenden Pärchen - angesprochen und von Schiebern zum vermeintlichen Traumjob ins Ausland verbracht wird, um dort dann die "Schulden" unter unmenschlichen Bedingungen abzuarbeiten. Durch Prostitution oder durch "Zwangsarbeit" in Branchen, wo illegale Billigst-Arbeitskräfte Gewinne ermöglichen.
Helga Konrad schätzt den Menschenhandel auf einen weltweiten Jahresumsatz von bis zu 30 Milliarden Dollar. Nahezu bescheiden nehmen sich da die Europol-Ziffern betreffend Drogen- und Zigarettenschmuggel aus: Je rund fünf Milliarden Euro - allerdings alleine in der EU - die Tendenz ist bei Zigaretten stark steigend.
Ist die EU schuld daran? Nein, ganz im Gegenteil: Sie spiele zentrale Rolle in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität am Balkan. Die Beitrittsperspektiven für diese Länder habe einen großen Anreiz für eine Veränderung der Strukturen und des Rechtssystems geboten. Der rechtliche Rahmen ist vorhanden - schilderte etwa Jörg Hofreiter die Situation in Bosnien und Herzegowina - es fehlt aber an der Umsetzung: So etwa die dringend nötige bosnische Polizeireform, wegen der die EU-Verhandlungen derzeit warten müssen.
Tatsächlich wurde das Rechtsystem vieler Osteuropäischer Staaten in den vergangenen Jahren stark verbessert - so dass EU-Standards teilweise sogar übertroffen werden - indem beispielsweise dort "organisierte Kriminalität" im Strafrecht definiert ist - was in viele westeuropäischen Ländern fehlt.Immer mehr entdecken Balkan-Staaten auch den wirtschaftlichen Nutzen des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität. Uwe Kranz macht auf Statistiken aufmerksam, nach denen Staaten mit schwachem Kontrollsystem auch die schwächsten Steuereinnahmen aufweisen. So wurden aus Albanien im Vorjahr drei Korruptionsfälle gemeldet - das "Musterland Kroatien" weise da ganz andere Ziffern aus.