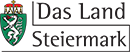Freundschaftsfahrt 2008
von Josef Bauer
1700 Freundschaftskilometer in vier Tagen! Und das bei prächtigstem Frühlingswetter, das für Tausende Fotos zu azurblauer Postkarten-Kulisse wurde. Gut, der Heilige Petrus hat auch gezeigt, dass er anders kann. Zwei, drei ordentliche Regenschauer ließ er niedergehen, aber er achtete dankenswerter Weise darauf, dass 107 Steirer diese Wasserwände vom Inneren der Watzke-Busse miterleben konnten. So blieb alles im Trockenen, und bei der Ankunft am Grazer Busbahnhof waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig: Viel gesehen, viel erlebt! Und so manche Erwartung war sogar übertroffen worden.
Aber der Reihe nach.
Dass heuer der „Tag der Arbeit" mit Christi Himmelfahrt eine kalendarische Einheit bildete, verdoppelte die gute Stimmung am frühen Morgen des 1. Mai. Alle waren pünktlich, niemand mit dem zugewiesenen Sitzplatz unglücklich, Delegations- und Reiseleiter bestens vorbereitet und die beiden Busfahrer fit wie Formel 1-Piloten vor einem Grand Prix.
Die ersten Kilometer bei einer derartigen Reise dienen den meisten der Orientierung. Es heißt, sich zurechtzufinden in der rollenden Makrowelt, die für die nächsten Tage Wohnzimmer und Ohrensessel, Schlummerstube und Tratschbude sein würde.
So verwundert es nicht, wenn der Grenzübergang Spielfeld/Sentilj trotz eines kurzen Halts („Hallo, da sind ja die Merlinis!") kaum noch wahrgenommen wird. Jedenfalls Zeit und Muße, die Hofrat Ludwig Rader im Großen Watzke mit 57 Gästen und Josef Bauer im Kleinen Watzke mit 48 Reiseteilnehmern zur Erläuterung dafür nutzen, wie die Entscheidung zugunsten dieser Route getroffen worden ist. Die Vorschläge für die Freundschaftsfahrt 2008 waren zahlreich gewesen; Friaul, Split sowie Ungarn und Rumänien entpuppten sich als die Favoriten. Da die Fachabteilung Europa und Außenbeziehungen bis Ende 2007 Leadpartner eines großen EU-geförderten Projektes war, an dem 16 Regionen aus sechs Staaten mit 250 Experten teilgenommen haben, sollte der Versuch unternommen werden, den Geist dieses Richtung weisenden Unterfangens mit Namen MATRIOSCA zu vermitteln. Ziel ist es, gemeinsam Mittel, Wege und Werkzeuge zu finden, wie trotz unterschiedlichster Verfassungen Regionen zugunsten ihrer Bürger effektiv zusammenarbeiten und dabei die vielfältigen Möglichkeiten der Europäischen Union voll ausschöpfen könnten.
Dessen unbeeindruckt schnurren die beiden vom Reisebüro Ringtours nach einem strengen Kriterienkatalog ausgewählten Brummis die slowenischen Kilometer respektlos herunter. Als wäre da weit und breit nichts Sehenswertes! Dass das Gegen¬teil der Fall ist, wissen wir alle und fast hat man im Bus selbst das Gefühl, dass sich die TeilnehmerInnen bei Land und Leuten entschuldigen wollen fürs Durchfahren: „Beim nächsten Mal, da bleiben wir hier, Euer Land ist wunderschön", lautet die gedachte Botschaft, um an der ersten Schengen-Außengrenze dieser Reise in eine bereits un¬österreichische EU-Realität gebremst zu werden: Passkontrolle!
Dass heuer der „Tag der Arbeit" mit Christi Himmelfahrt eine kalendarische Einheit bildete, verdoppelte die gute Stimmung am frühen Morgen des 1. Mai. Alle waren pünktlich, niemand mit dem zugewiesenen Sitzplatz unglücklich, Delegations- und Reiseleiter bestens vorbereitet und die beiden Busfahrer fit wie Formel 1-Piloten vor einem Grand Prix.
Die ersten Kilometer bei einer derartigen Reise dienen den meisten der Orientierung. Es heißt, sich zurechtzufinden in der rollenden Makrowelt, die für die nächsten Tage Wohnzimmer und Ohrensessel, Schlummerstube und Tratschbude sein würde.
So verwundert es nicht, wenn der Grenzübergang Spielfeld/Sentilj trotz eines kurzen Halts („Hallo, da sind ja die Merlinis!") kaum noch wahrgenommen wird. Jedenfalls Zeit und Muße, die Hofrat Ludwig Rader im Großen Watzke mit 57 Gästen und Josef Bauer im Kleinen Watzke mit 48 Reiseteilnehmern zur Erläuterung dafür nutzen, wie die Entscheidung zugunsten dieser Route getroffen worden ist. Die Vorschläge für die Freundschaftsfahrt 2008 waren zahlreich gewesen; Friaul, Split sowie Ungarn und Rumänien entpuppten sich als die Favoriten. Da die Fachabteilung Europa und Außenbeziehungen bis Ende 2007 Leadpartner eines großen EU-geförderten Projektes war, an dem 16 Regionen aus sechs Staaten mit 250 Experten teilgenommen haben, sollte der Versuch unternommen werden, den Geist dieses Richtung weisenden Unterfangens mit Namen MATRIOSCA zu vermitteln. Ziel ist es, gemeinsam Mittel, Wege und Werkzeuge zu finden, wie trotz unterschiedlichster Verfassungen Regionen zugunsten ihrer Bürger effektiv zusammenarbeiten und dabei die vielfältigen Möglichkeiten der Europäischen Union voll ausschöpfen könnten.
Dessen unbeeindruckt schnurren die beiden vom Reisebüro Ringtours nach einem strengen Kriterienkatalog ausgewählten Brummis die slowenischen Kilometer respektlos herunter. Als wäre da weit und breit nichts Sehenswertes! Dass das Gegen¬teil der Fall ist, wissen wir alle und fast hat man im Bus selbst das Gefühl, dass sich die TeilnehmerInnen bei Land und Leuten entschuldigen wollen fürs Durchfahren: „Beim nächsten Mal, da bleiben wir hier, Euer Land ist wunderschön", lautet die gedachte Botschaft, um an der ersten Schengen-Außengrenze dieser Reise in eine bereits un¬österreichische EU-Realität gebremst zu werden: Passkontrolle!
Varazdin – Gräfin Mariza lässt grüßen
Varaždin ist heute Verwaltungssitz der gleichnamigen Gespanschaft, mit welcher die steirische Landesregierung auch in Brüssel „gemeinsame Sache" macht: Die Regionalregierung ist Mieter von Büros im Steiermarkhaus, wo mittlerweile fünf Nationen im bestem Einvernehmen kooperieren.
Fahnengeschmückt die Einfahrt nach Varaždin, noch schlaftrunken der Platz zwischen Rathaus und herrlicher innerstädtischer Parkanlage. Der Wirtschaftslandesrat der Gespanschaft, Darko Hrencic und der Vizebürgermeister von Varazdin, Predrag Štromar haben es sich gemeinsam mit Romana Krajncic nicht nehmen lassen, den von unserem Kroatien-Referenten Johnny Steinbach organisierten Termin wahrzunehmen. Herzlich die Begrüßung, ein TV-Team schwenkt eine Kamera über die 100köpfige Steirer-Schar, die begeistert durch die prachtvolle Barockstadt zur Burganlage trabt.
Ein Teil schafft auf Anraten von Dr. Hermann noch einen Abstecher zu einem der schönsten Friedhöfe Europas - wie würdevoll hier die Verstorbenen behandelt werden!
Seit 1971 gibt es in der früheren Königsstadt regelmäßig Barockmusikabende und im Sommer geht das traditionelle Špancirfest-Festival über die Bühne, bei dem internationale Akrobaten, Zauberkünstler, Schauspieler, Tänzer, Musiker, Clowns und im Stil des Barock kostümierte Spaziergänger auftreten.
Dass in Kroatien der in der Steiermark tätige Honorarkonsul Dr. Nick Hermann dem Reiseleiter des Bus 2, Mag. Wolfram Liebenwein, kurz die Show stiehlt, versteht sich von selbst. Zumindest für jene, die „den Nick" kennen! Fachkundig und mit unglaublichem Detailwissen erläutert er Geschichte, indem er Geschichten erzählt, macht geografische Ausdehnungen deutlich, indem er Grenzen zieht, kurz - Nick Hermann lässt dankbare Busreisende teilhaben an seiner Faszination für dieses frühere Königreich und dieses künftige Land der Europäischen Union.
Mittag. Die beiden Busse nähern sich über Virovitica vom Süden her der EU, fast belustigt zeigt man seinen Pass, bittet den Zollbeamten in Barcs um einen Stempel. Wer weiß, wie lange es das noch gibt. Weiter nach Szigetvar. Es ist fast hochsommerlich schwül und vom fernen Park tönt Volksmusik.
Kesselgulasch mit Volksfeststimmung
Die telefonisch übermittelte Nachricht, dass bei der nächsten Station in Boly eine nicht vorhersehbar gewesene Programmänderung dazu führt, dass es dort kein Mittagessen für die Gruppe gibt, führt zu kurzzeitiger Konfusion, die die Reise- und Delegationsleiter aber entschlossen in den Griff bekommen: Wir essen hier und bleiben eine Stunde länger in Szigetvar! Der schöne Park mit den Zelten, die Volksfeststimmung und der Duft von frisch zubereitetem Kesselgulasch lassen uns die Atmosphäre genießen. Freundliche Ungarn, die für ihre Partei ein Maifest zum Tag der Arbeit organisiert haben, laden einen großen Teil der hungrigen steirischen Truppe sogar ein zu Gulyas, Würstel, Bier.
Szigetvár - die Inselburg - war 1566 Schauplatz einer mörderischen Schlacht, deren Ausgang das Vordringen der Türken gegen Wien zwischenzeitlich aufhielt und die mehr als 20.000 Kombattanten den Tod brachte. Auf dem ehemaligen Schlachtfeld findet sich seit 1996 ein Park der ungarisch-türkischen Freundschaft mit einem Denkmal, das die beiden Widersacher der Schlacht von 1566 zeigt - Sultan Süleyman I. und den Heerführer der Ungarn, Miklós Zrínyi.
Die Burg, deren Reste von den Türken geschleift worden war, wurde nach 1960 restauriert. Aus der Zeit der türkischen Besatzung sind noch mehrere Bauwerke zu sehen. So steht auf dem Zrinyi-Platz die ehemalige Moschee Ali Paschas, ursprünglich 1569 mit zwei Minaretten errichtet, die 1788 zu einer barocken römisch-katholischen Kirche umgebaut wurde.
Wir befinden uns in einer geschichtsträchtigen Region und bewegen uns auf der Achse Szigetvár - Móhacs weiter, erfahren viel über das Verhältnis zwischen Osmanen und Ungarn und nehmen zur Kenntnis, dass die Magyaren auch Vorteile aus der Zeit der Türkenherrschaft erkennen können und schätzen. Das Verhältnis zwischen Bosporus und Budapest ist heute vorbildhaft entspannt, freundschaftlich.
Die Burg, deren Reste von den Türken geschleift worden war, wurde nach 1960 restauriert. Aus der Zeit der türkischen Besatzung sind noch mehrere Bauwerke zu sehen. So steht auf dem Zrinyi-Platz die ehemalige Moschee Ali Paschas, ursprünglich 1569 mit zwei Minaretten errichtet, die 1788 zu einer barocken römisch-katholischen Kirche umgebaut wurde.
Wir befinden uns in einer geschichtsträchtigen Region und bewegen uns auf der Achse Szigetvár - Móhacs weiter, erfahren viel über das Verhältnis zwischen Osmanen und Ungarn und nehmen zur Kenntnis, dass die Magyaren auch Vorteile aus der Zeit der Türkenherrschaft erkennen können und schätzen. Das Verhältnis zwischen Bosporus und Budapest ist heute vorbildhaft entspannt, freundschaftlich.
Boly – wie lange noch Geheimtipp
Frühlingshaft frisches Grün begleitet uns weiter entlang der Strecke nach Boly - einer kleinen Stadt im Südosten von Fünfkirchen (Pécs), wo uns Komitatspräsident Dr. Janos Hargitai und Bürgermeister Jozsef Hárs begrüßen. Ein Reisebus mit FB-Kennzeichen zeigt auf, dass Boly zwar nach wie vor ein Gehimtipp ist, aber doch schon lange zuvor von der Steiermark entdeckt worden ist, und mit Christl Hofmeister vom der Europäischen Föderalistischen Bewegung gibt sich auch die Entdeckerin dieses idyllischen Weißweinortes zu erkennen. Schade, dass wir nicht etwas mehr Zeit haben, etwa um das kleine Schloss zu sehen und seinen schönen Park.
Dr. Hargitai, als Komitatspräsident der Baranya im Rang eines Landeshauptmanns, streicht in seiner Rede die langjährigen außerordentlich freundschaftlichen Beziehungen zur Steiermark und besonders die der beiden europäischen Kulturhauptstädte Graz und Pécs heraus. Hofrat Rader bekundet die Freude, mit der Baranya zu kooperieren und hofft, dass es bald wieder EU-Projekte sind, die Steirer und Südungarn zusammenführen.
Jetzt aber ist es der Wein, der uns verbindet! Der Herr Bürgermeister ignoriert Blitz und Donner und Regenschauer und erweist sich als profunder Önologe. Klar, dass unser Zeitplan vollends durcheinander gerät - aber es ist gemütlich in dieser ehemaligen großen alten Mühle, die die Gemeinde zu einem schönen Kommunikationszentrum umgestaltet hat. Nach dem siebenten Wein, kredenzt von hübschen Ungarinnen, in deren Familien die deutsche Sprache als Reminiszenz an die Einwanderung unter Maria Theresia gepflegt wird und nach einigen köstlichen Kipfli ist Schluss und wir eilen nach Pécs.
Pécs verzaubert im Zsolnay-Licht
Die Stadt empfängt uns nach einem Regenguss in goldnem Abendlicht. So feurig-schimmernd, dass Miklos Zsolnay, der große Keramiker, seine Freude an dem Farbenspiel am Szechenyi-tér gehabt hätte. Das protzigschöne Dach des Komitatsgebäudes, das Rathaus mit dem Glockenspiel, die stolzen Bürgerhäuser, die Kirche am oberen Platz, die unverkennbar Moschee gewesen ist, und der kleine Zsolnay-Brunnen beeindrucken und bezaubern zugleich. Die Fußgängerzone vom Palatinus-Hotel hinüber zum Stadttheater mit den kleinen Geschäften und Konditoreien verführt zum Bummeln - wir aber haben schon wieder zu wenig Zeit!
Die Zsolnay-Manufaktur in Pécs hinterlässt Spuren, ob an der Nationalbank und an der Kunsthalle in Budapest, in der Kärntner Straße in Wien, am Museum der Schönen Künste in Mexiko-City und in unzähligen Haushalten in der ganzen Welt: die Keramik-Manufaktur Zsolnay im südwestungarischen Pécs. Bis ins Jahr 1853 reicht die Geschichte des Familienbetriebs zurück. Aus der ehemaligen Steingutfabrik wurde damals eine Manufaktur, die heute international mit ihren Fayencen und sezessionistisch-geprägten Motiven Erfolg hat. Mehr noch: Das Fabrikgelände ist ein Schlüsselprojekt im Rahmen der Aktivitäten zur "Kulturhauptstadt Europas 2010 Pécs". Hier soll bis zum Kulturjahr das Zsolnay-Kulturviertel entstehen.
Beim Abendessen im Hotel-Restaurant des Palatinus (übrigens ein Jugendstilhotel mit einem museal-sehenswerten Treppenhaus) beehrte uns in Vertretung des Fünfkirchner Bürgermeisters Péter Tasnádi dessen Vize, Tibor Gonda, der sich in ausgezeichnetem Deutsch angeregt mit der Repräsentantin der steirischen Landeshauptstadt, Frau Gemeinderätin Gerda Gesek unterhält. Seitens der Komitatsverwaltung ist unser lieber Freund József Végh gekommen, der als einer der Väter der Freundschaft zwischen Graz und Pécs und vor allem zwischen der Steiermark und der Baranya anzusehen ist.
Die Nacht ist kurz, wir schlafen etwas schneller, um am Morgen doch noch einen kleinen Rundgang zu unternehmen. Vom Hauptplatz (der in jeder zweiten Stadt nach Graf Szechenyi benannt ist) mit der in der Morgensonne thronenden Pfarrkirche, vorbei an den Tausenden Schlössern sich ewiger Treue versprochen habender Liebespaare hinüber auf die dicken Glasplatten, die den Blick freigeben hinunter auf eine urchristliche Kapelle. Ein Teil schafft es, trotz morgendlicher Stunde in den eindrucksvollen Dom zu gelangen und auch die Krypta zu besichtigen. Da muss man wohl wieder her, wird der Wunsch laut nach einer Fahrt im Sonderzug - wenn möglich, schon vor dem Kulturhauptstadtjahr. Spätestens aber dann!
Die Schlacht von Mohács (I und II)
Hat ihr Geschichtelehrer auch so darauf herumgehackt? Mussten Sie auch alles wissen, was damals, an diesem heißen Augusttag des Jahres 1526, in diesem südungarischen von Sümpfen durchzogenem Gebiet passierte?










Nun, in aller Kürze: In der Schlacht Nummer eins von Mohács erlitt das Heer des Vielvölker-Königreiches Ungarn unter König Lajos II. und dem Feldherrn und Erzbischof Pál Tomori gegen die Osmanen unter Süleyman I. am 29. August 1526 eine vernichtende Niederlage. Nach der Schlacht konnten die Türken große Teile Ungarns und Kroatiens einnehmen und in das Osmanische Reich eingliedern.
Süleyman hatte von den Ungarn Tribut gefordert, und als diese die Zahlung verweigerten, marschierte er mit einer etwa 60.000 bis 70.000 Mann starken Armee aus Belgrad kommend Richtung Norden, zu der 10.000 Reiter ("Sipahis") und 12.000 Janitscharen als Elitetruppen gehörten. König Lajos brach am 15. August mit seinem Heer von ungefähr 25.000 bis 40.000 Mann, das zum größten Teil aus Bauern bestand, von Tolna auf. Das Heerlager wurde in der Nähe des Dorfes Mohács aufgeschlagen. Hier wollte man auf weitere Truppen warten. So hatte der siebenbürgische Woiwode Johann Zápolya mehrfach die Aufforderung erhalten, mit seinen Truppen zum König zu stoßen. Er ließ aber auf sich warten. Das osmanische Heer überschritt am 20. August die Drau und stand am 29. dem ungarischen Heer gegenüber.
Warnungen, den Kampf nicht ohne vorherige Kenntnis der osmanischen Schlachtordnung zu beginnen, wurden von den ungarischen Adeligen nicht zur Kenntnis genommen. Man wollte die Osmanen in die Flucht schlagen. Als sich dann eine osmanische Einheit von Sipahis zeigte, griff die gesamte schwere Reiterei der Ungarn an, obwohl erst ein Teil des ungarischen Heeres (28.000 bis 30.000 Mann) kampfbereit aufgestellt war. Die Sipahis aber zogen sich geordnet zurück und lockten die Ungarn in einen Hinterhalt osmanischer Artillerie. Im Geschützfeuer wurden Hundertschaften von Ungarn getötet (erstes geschichtlich registriertes Artillerie-Sperrfeuer), und es setzte eine allgemeine Panik ein. Die fliehenden Einheiten von König Lájos wurden von den nachrückenden Osmanen in die Sümpfe getrieben. 12.000 Ungarn wurden enthauptet. Der König selbst wurde tot aufgefunden. In dieser Schlacht starben mehr als 24.000 ungarische Soldaten. Das Dorf Mohács wurde niedergebrannt und alle Bauern, die in der Nähe waren, wurden zur Abschreckung getötet. Süleyman erreichte am 10. September Buda, zog sich aber zurück und führte mehr als 100.000 Ungarn in die Sklaverei.
Die Zeit reicht uns Steirern gerade zum Gedenken an die Zehntausenden Hingeschlachteten, aus deren Blut eine neue Ära im zentralen Europa erwuchs. Die Herrschaft der Türken begann und sollte mehr als eineinhalb Jahrhunderte dauern und durch die Schlacht Nummer zwei, ganz in der Nähe von Mohács, nämlich am Berg Hársany im Jahr 1687 zugunsten des Hauses Habsburg beendet werden. Diese Schlacht zwischen dem kaiserlichen österreichischen Heer und dem Heer des Osmanischen Reiches war einer der militärischen Höhepunkte während des Großen Türkenkrieges (1683-1699). Beeindruckt vom Sieg anerkannten die ungarischen Stände auf dem Pressburger Reichstag die habsburg'sche Erblichkeit der Stephanskrone.
Um die Erinnerung an die Niederlage der böhmischen und ungarischen Christen gegen die Osmanen im Jahre 1526 zu verwischen, entschied sich die Geschichtsschreibung, das Gemetzel von Hársany ebenfalls als Schlacht bei Mohács zu bezeichnen, obwohl der Ort der früheren Schlacht mehrere Kilometer entfernt lag.
Kurzer Blick in die Vojvodina, Serbien
Genug der Geschichte, auf in die Zukunft. Der Große Watzke setzt über die südlichste Donaubrücke Ungarns nach Baja, der Kleine nimmt die Fähre von Mohács und schafft es so, auf der Fahrt nach Szeged entlang knallgelber Rapsfelder zumindest ganz in der Nähe der Vojvodina zu bleiben.
Die mit Spannung erwarteten Wahlen in Serbien sehen auch die mit der Steiermark eng zusammenarbeitende Vojvodina vor einer historischen Weggabelung. Univ.-Prof. Dr. Hubert Isak gibt im Zweier-Bus einen kurzen Einblick in die Situation, zeichnet die kompliziert scheinende Parteienlandschaft und verweist auf die europapolitische Dimension der Wahl. Mittlerweile wissen wir, dass sich die Menschen erfreulicherweise mehrheitlich zugunsten Europas entschieden und die Nationalisten einen demokratiepolitischen Dämpfer erhalten haben. Möglich, dass der eine oder andere österreichische Wahlhelfer nicht wirklich positiv auf das modern denkende Serbien gewirkt hat ...
Nun, es hängt jetzt vom Verhandlungsgeschick der Wahlsieger ab, und wohl auch von der Unterstützung, die die EU dieser in jüngster Zeit wahrlich gebeutelten Republik angedeihen lässt.
Die Fahrt nach Szeged lässt Erinnerungen an die sprichwörtlichen „Mühen der Ebene" wach werden, und der Hinweis auf die kulinarischen Highlights ist untrennbar verbunden mit den 2100 jährlichen Sonnenstunden, die dem Paprika die herrrrrliche Würrrze verrleihen - dieses sanftrote Gewürz mit dem mehlig-scharfen Geschmack wird u.a. reichlich in der Szegediner Fischsuppe verwendet.
Übrigens: Der deutsche Name für das Szegediner Gulasch kommt nicht von Szeged. Die ursprüngliche ungarische Bezeichnung ist Székely gulyás und geht auf den Namen des ungarischen Schriftstellers und Dichters József Székely (1825-1895) zurück.
Einige Freundschaftsfahrt-Teilnehmer gehen noch auf die „Jagd" nach der weltberühmten eigentlichen kulinarischen Spezialität dieser Stadt, der Pick-Salami, und werden trotz Feiertagsstimmung fündig.
Die lausigen Zeiten scheinen vorbei
Der kurze Aufenthalt in der Csongráder Komitatshauptstadt hat die Teilnehmer (teils gestärkt auch durch delikate Esterházy- oder Dobos-Torte) gut vorbereitet auf den heutigen Abend. Temeschwar, Rumänien, erwartet uns. Freilich verbinden viele diesen Namen mit der Revolution gegen das Ceausescu Regime, manche aber auch mit Straßenkindern, die im Kanalsystem Zuflucht suchen. Kindern am Rande der Gesellschaft zu helfen ist das große Anliegen von Helga und Walter Tiffinger. Bereits in Graz haben sie eine vorbildhafte Sammelaktion gestartet, der sich auch im Bus niemand entziehen kann. Es klimpert und knistert im herumgereichten Körberl und die glänzenden Augen der Heimleiterin richten wenige Stunden später ein vielsagendes, von Herzen kommendes Danke aus. Begeistert werden die Fußbälle (FA1E) einer ersten Bewährungsprobe unterzogen, mit Jubel die von Dr. Wolfgang Martelanz (WK Stmk) organisierten Fußballschuhe wahrgenommen, die GAK-Dressen, die Unterwäsche und die nach Schokolade duftenden Kartons erwartungsvoll beäugt. Nadine ist besonders erfreut über die Großpackung Haarshampoo (gestiftet vom Pharma-Unternehmen Dr. Doskar) mit dem 100 Kinderköpfe eine Zeitlang glänzendes und vor allem von lästigen Insekten befreites Haar erhalten würden.
Das Hotel Continental im Zentrum der Stadt verströmt Ostblockcharme, die für die Ansprachen bestellte Tonanlage lässt müde das Mikro hängen und demonstriert ihre Unlust durch akustische Aussetzer. Das tut dem rhetorischen Esprit des Österreichischen Botschafters in Bukarest, der dankenswerter Weise unsretwegen angereist ist, keinen Abbruch und gebannt folgen 107 Steirerinnen und Steirer den Ausführungen Seiner Exzellenz.
Botschafter Dr. Martin Eichtinger ist voll des Lobes über Rumänien. Österreichs Wirtschaft habe Pionierleistungen erbracht und rund 12 Milliarden Euro investiert, stellt er mit Stolz fest und hebt hervor, dass 30 Prozent der Banken und 44 Prozent der Versicherungen in österreichischem Besitz seien; die OMV als Mehrheitseigner der Petrom erweise sich als Energieriese und profitiere von dem rasanten Wachstum, das kontinuierlich die Sechsprozentmarke überschreitet. Hier, in Timisoara, sei besonders eindrucksvoll, dass die Arbeitslosigkeit auf 1,5 Prozent zurückgegangen sei - es herrsche Vollbeschäftigung und das größte wirtschaftliche Problem sei der Mangel an Fachkräften! Eichtinger zeigte sich zuversichtlich, dass Rumänien auch die nächsten Hürden mit Unterstützung durch die Europäische Union meistern würde.
Mit großer Freude wurde die Delegation aus Reschitza und Steierdorf begrüßt, die unserer Einladung zu diesem Abend gefolgt war. Erwin Josef Ţigla, Präsident des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen, bedankte sich in bewegten Worten und freute sich bereits auf den Tag danach, der die steirische Reisegruppe in seine Heimat bringen würde. Er machte deutlich, dass trotz Wirtschaftswachstum noch einige soziale Hürden zu bewältigen seien. So habe ein Universitätsprofessor mit rund 400 Euro im Monat das Auslangen zu finden, ein durchschnittlicher Angestellter komme auf etwas mehr als 200 und einem Pensionisten blieben lediglich 80 bis 100 Euro zum (Über)leben. Übrigens: Die Steierdorfer fuhren noch in der Nacht zurück und kamen nach drei Uhr Früh zu Hause an!
Dass die Belegschaft des Continental noch nicht ganz die EU-Standards erreicht hat, erfuhren einige Teilnehmerinnen, als es ans Zahlen ging: Der Aufpreis für ein billiges Fischgericht erreichte Haubenkategorie, die dem Gericht selbst fremd war, und dass ein Glas des gleichen Weins an einem Tisch unverschämte 3,50 kostete und am Tisch daneben horrende sechs Euro, überschritt die Toleranzgrenze nun doch. Und die Hotelbar musste um 23 Uhr die Pforten dicht machen - man verwies uns auf den Club Galaxy - mit „atmosfera intima si relaxanta" und „rafinat si sofisticat dance show". Aber darauf hatte keiner so richtig Lust. Ein Bierchen an der Bar, auch zu rumänischen Preisen, das wär's gewesen.