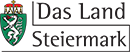EU - Alles ist möglich?! Europa für Junge, Aktive und Mobile ...
Jugendworkshop und Diskussion zur Europawahl 2009 im Medienzentrum Steiermark




Graz [27.03.2009] - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „EU - (K)ein Ungeheuer" fand gestern, Donnerstag, unter dem Titel „EU - Alles ist möglich!?" ein spannender Schlagabtausch zwischen glühenden Europäern und solchen, die flammend für so manche Verbesserungen in der Europäischen Union plädieren, statt. Welche Möglichkeiten werden den Jungen, Aktiven und Mobilen von der EU wirklich geboten? Ist die EU eine Union für Eliten und bleiben sozial Schwächere auf der Strecke? Um diese und andere Fragen zu beantworten, kamen zum bereits vierten Mal Politiker, Experten, Jugendliche und andere Interessierte im Medienzentrum Steiermark zusammen.
In einem Jugendworkshop und einer anschließenden Diskussionsrunde wurde mit Schülern aus der ganzen Steiermark über Weiterbildung im Ausland gesprochen. Am Expertentisch saßen diesmal Brigitte Hasewend, Verantwortliche für Internationale und Strategische Partnerschaften an der TU Graz, und Christian Ehetreiber von der ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus. Ebenfalls an der Diskussion beteiligt haben sich die Gemeinderätinnen Christina Jahn (Die Grünen) und Claudia Michaela Kürzl (SPÖ) sowie besonders engagiert der Landtagsabgeordnete und frühere Europa-Landesrat Gerald Schöpfer (ÖVP). Moderiert wurde der Abend in bewährter Weise von Bernhard Possert vom Forum politische Bildung Steiermark, das zusammen mit der Fachabteilung für Europa- und Außenbeziehungen (FA1E) des Landes Steiermark für die Veranstaltungsreihe verantwortlich zeichnet.
Unsicherheitsfaktor Tschechien
Zu Beginn des Jugendworkshops nahm Ludwig Rader, Leiter der Fachabteilung 1E, Stellung zur Regierungskrise des aktuellen EU-Vorsitzlandes Tschechien. Er sehe den Prager Regierungssturz weniger als Gefahr denn als Chance für die EU-Politik, zumal sich der in Ungnade gefallene Ministerpräsident Mirek Topolánek nun mehr als vorher um europäische Fragen kümmern könne. Außerdem bestünden Zusagen aller tschechischen Parteien, die Regierungsperiode durchzuhalten, sodass die Organisation der EU in keiner Weise gefährdet sei.
Versorgung abseits der Elite
Im Hinblick auf die Erwartungen von jungen Menschen an die Europäischen Union, sagte Brigitte Hasewend von der TU Graz, dass in einem sozialen Europa nicht nur Eliten, sondern auch weniger Privilegierte Chancen hätten. Dennoch müsse sich Europa etwas einfallen lassen und bestehende Strukturen aufbrechen, um die Gesellschaft zu stärken und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Angesprochen auf die Kritik zu den zum Teil untransparenten Entscheidungsprozessen in der EU, entgegnete sie, dass man eben versuchen müsse, den Bürgern die EU besser zu kommunizieren.
Diesen Gedanken griff Christian Ehetreiber auf und gab zu bedenken, dass mit der EU etwas nicht stimmen könne, wenn man sie die Menschen erklären müsse: „Ich stehe für ein soziales, armutssicheres Europa, das sich selbst erklärt, alles andere ist Zynismus." Er forderte ein Ende des „neoliberalen Wahnsinns" und die Durchsetzung sozialer Maßnahmen, wie die Einführung einer Mindestsicherung von 900 Euro und deutlich höherer Kollektivverträge. Außerdem sei es für das Funktionieren eines grenzübergreifenden sozialen Netzwerks notwendig, dass auch jene sichere Arbeitsplätze haben, die nicht zur Elite gehören. Die Krise sollte diesbezüglich als Chance genutzt werden, doch leider habe die Bundesregierung „offenkundig gar nichts gelernt", schoss Ehetreiber scharf in die Richtung der österreichischen Politik.
Dem begegnete ÖVP-Gemeinderat Schöpfer mit dem Argument, dass Österreich als (öko)soziale Marktwirtschaft im Vergleich zu anderen Staaten wie den USA in Sachen sozialer Sicherheit sehr gut aufgestellt sei. Weniger problematisch sah Schöpfer den von Ehetreiber kritisierten Neoliberalismus, als den zunehmenden Mangel an Jungen, die das Sozialsystem tragen würden. Auf das Problem der Jugendarbeitslosigkeit angesprochen, entgegnete er, dass die Jugend in der EU mehr Möglichkeiten hätten denn je.
In dem Zusammenhang betonte Claudia Michaela Kürzl von der SPÖ, dass sie die europäische Jugend für sehr kritisch halte. Zwar sehe sich die 24-Jährige selbst als „Teil von etwas Größerem", mahnte aber ein, dass der Mensch in den Mittelpunkt dieses Konstrukts gerückt werden müsse.
Ein proeuropäisches Plädoyer hielt auch Christina Jahn von den Grünen, die die Vorteile eines gemeinsamen europäischen Weges vor allem im Hinblick auf Globalisierung und Klimawandel sieht. Das Problem des Klimawandels etwa beträfe nicht nur einzelne Länder und könne daher auch nicht nationalstaatlich bewältigt werden. Zudem hätten Nationalstaaten wesentlich bessere Karten, wenn sie sich in der Zeit der Globalisierung gemeinsam den Herausforderungen stellten. Freilich, bei 27 Mitgliedsstaaten und beinahe 500 Millionen Bürgern, könne man sich halt „nicht immer alle Rosinen behalten."
Gut informiert?
In der Runde gab es einen grundsätzlichen Konsens über ein Bekenntnis zum Projekt Europa, doch tauchte der Satz "Ich bin ein glühender Europäer, ABER..." im Laufe der Diskussion immer wieder auf. Kontroversiell wurde es vor allem bei der Frage, ob es die Aufgabe der EU sei, die Bürger über ihre Entscheidungen sowie über die anstehenden Europawahlen ausschließlich aktiv zu informieren, oder ob hier nicht auch die Bürger selbst Verantwortung übernehmen müssten. Der slowensiche Honorarkonsul Kurt Oktabetz brachte seinen Standpunkt in der Publikumsdiskussion auf den Punkt: „Information ist nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Holschuld." Diese Ansicht wurde nicht von allen geteilt, kam doch aus dem Publikum die Kritik, dass man aus den Informationsquellen der EU nur schwer Verwertbares holen könne, wenn man nicht fließend Englisch spreche oder einen Doktortitel in Jura habe.
In der Kritik der Bürger an der EU sah Ludwig Rader von der Fachabteilung für Europa und Außenbeziehungen eine gewisse Widersprüchlichkeit. Man wolle zwar, dass die EU gute Arbeit leistet, gleichzeitig aber wenig bis gar nichts in diese gute Arbeit investieren. Den eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraum der EU veranschaulichte er mittels eines einfachen Vergleichs. Das Budget für die 27 Mitgliedsstaaten und knapp 500 Millionen Einwohner der EU sei gerade einmal so groß wie jenes für die acht Millionen ÖsterreicherInnen. „Das sind Peanuts", mit denen man nicht viel erreichen könne. Zudem ortete Rader in den nationalen Egoismen einen Hemmschuh für die gesamteuropäische Idee. Der Vertrag von Lissabon würde die Europäische Union in ihrer Entscheidungsfähigkeit einen großen Schritt voranbringen, doch solange die Ratifizierung durch großteils einzelstaatliche Befindlichkeiten blockiert werde, könne sie sich nicht weiterentwickeln. Rader unterstreicht: „Damit ich in die richtige Richtung gehen kann, muss ich erst gehen können. Protestaktivitäten gegen die EU verhindern aber dieses Gehen." Einer Volksabstimmung über den Lissabonvertrag kann er nichts abgewinnen, da man als mündiger Bürger nicht über etwas entscheiden könne, dessen Inhalt man gar nicht kenne. Diese Abstimmung würde somit allenfalls einem Ventil für die Emotionen der EU-BürgerInnen gleichkommen, aber keine inhaltlichen Ergebnisse bringen. „Wenn die Bürgerinnen und Bürger die EU wirklich nicht mehr wollen, dann lassen wir doch dezidiert darüber abstimmen, aber nicht vor dem Vorwand einer Abstimmung über den Lissabonvertrag."
In seinem Schlusssatz brachte Abteilungsleiter Rader seine Freude über die rege und angeregte Beteiligung an der Diskussionsrunde sowie an der gesamten Veranstaltungsreihe „EU - (K)ein Ungeheuer" zum Ausdruck. Schließlich können wir Europa nur über konstruktiven Gedankenaustausch und durchaus auch kontroversielle Diskussionen Schritt für Schritt voranbringen und so letztendlich in die richtige Richtung gehen lassen.
Text: Daniela Neubacher / Gernot Walter